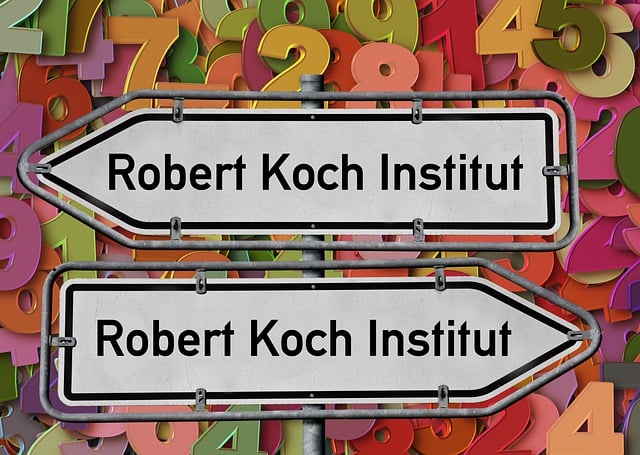Was wäre, wenn der Lehrstuhl an der Berliner Charité nicht von Christian Drosten sondern seinem Bonner Nachfolger Hendrik Streeck besetzt wäre und somit nicht Drosten sondern Streeck der Fachmann für die Virologie in Berlin wäre?
Das folgende Interview aus der WELT ist deutlich in den Unterschieden der Einschätzung des Krankheitsgeschehens. Man fragt sich, warum es so unmöglich sein sollte, dass Positionen, wie Hendrik Streeck sie mit Zurückhaltung und Vorsicht äußert, zumindest im Parlament diskutiert werden.
HENDRIK STREECK
„Wir dürfen unser Leben nicht von Viren bestimmen lassen“
Hendrik Streeck steht als Virologe seit einem Jahr an der vordersten Front der Pandemie. Und er steht unter Beschuss, denn er glaubt, dass wir mit Corona leben können. Ein Gespräch über die trügerische Hoffnung, das Virus werde verschwinden.
893
Es rauscht in der Leitung, Hendrik Streeck nimmt ab. Hinter ihm liegt ein ungewöhnliches Jahr, von dem er in seinem Buch „Hotspot“ berichtet. Einerseits stand Streeck als Virologe an der vordersten Front der Pandemie – und reiste etwa als einziger Forscher nach Gangelt bei Heinsberg, in den ersten Hotspot in Deutschland. Andererseits wurde er, der einen pragmatischen Umgang mit Corona vorschlägt angefeindet, wie wenige seiner Kollegen. Dennoch gehört der Bonner Professor, 43 Jahre alt, nicht zu jenen, die in der Pandemie verbittern. Er lacht oft, stellt sich immer wieder selbst infrage.
WELT: Herr Streeck, haben Sie Angst, in diesem Gespräch ein falsches Wort zu sagen, das gegen Sie verwendet werden kann?
Hendrik Streeck: Angst ist oft kein guter Ratgeber. Ich bin im Umgang mit den Medien im letzten Jahr durch verschiedene Phasen gegangen. Erst war ich zu naiv, dann eher vorsichtig. Mittlerweile habe ich mich entschieden, möglichst fokussiert das zu sagen, wovon ich überzeugt bin.
WELT: In den letzten Tagen gab es in den sozialen Medien Leute, die behaupten, Sie wollten „Menschenexperimente“ durchführen.
Streeck: Ich habe bei „Maischberger“ dafür plädiert, genauer zu bestimmen, was die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems sind. Dazu habe ich angeregt, einen „Stresstest“ durchzuführen. Die Leute, die mich da angreifen, wissen wahrscheinlich nicht, dass ein „Stresstest“ eine Computersimulation ist. Das wird bei Banken gemacht, um zu sehen, ob es potentielle Probleme gibt, wann ein Zusammenbruch droht. Es würde uns zeigen, wo bestimmte Regionen bei zu vielen COVID19-Patienten nicht mehr klar kommen würden. Wie würde man weiter vorgehen? Ich glaube nicht, dass wir darauf schon Antworten haben. Keiner will in diese Notsituation kommen, aber es ist besser, wenn man darauf vorbereitet ist. Man will mich aber falsch verstehen, vor allem auf Twitter.
WELT: Twitter ist eine Parallelwirklichkeit.
Streeck: Das Gefährliche daran ist, dass sich der Eindruck irgendwann verhärten könnte: steter Tropfen, durch Wiederholungen und Likes.
WELT: In einem „Spiegel“-Interview mit Ihrem Fachkollegen Christian Drosten behaupteten die beiden Fragestellerinnen letzte Woche, Wissenschaftler wie Sie und Jonas Schmidt-Chanasit, die einige Maßnahmen kritisch sehen, hätten „größeren Schaden als Corona-Leugner angerichtet“.
Streeck: Das macht mich sprachlos. Man wird Arzt, weil man alles tun will, um Schaden vom Menschen abzuwenden: Primum nihil nocere, erstens nicht schaden. Was mich perplex macht, ist, dass die Redakteurinnen in diesem Zusammenhang selbst Falschaussagen verbreiten und etwa behaupten, es sei eine Tatsache, dass man Risikogruppen bei hohen Fallzahlen nicht schützen könne. Es gibt aber inzwischen viele Berichte von Orten, wo es gelingt, Altenheime auch in der gegenwärtigen Infektionslage zu schützen und Einträge weitgehend herauszuhalten. In Tübingen etwa, auch in einem Heim in der Nähe von Bonn. So zu tun, als gäbe es eine universelle Wahrheit und einen, der sie hütet, ist unwissenschaftlich.
Wir können Risikogruppen besser schützen
WELT: Sie haben nun, mithilfe der Autorin Margret Trebbe-Plath, ein Buch über Ihre Erfahrungen im letzten Jahr geschrieben. Spielt Literatur in Ihrem Leben eine Rolle?
Streeck: Ich lese ja berufsbedingt den ganzen Tag Studien, da komme ich kaum noch zu Romanen. Was ich früher viel gelesen habe, war John Irving. „Das Hotel New Hampshire“, „Garp“, „Gottes Werk und Teufels Beitrag“. Aber ich hatte immer auch einen Hang, philosophisch zu lesen. Vor allem Thomas Mann, wobei ich mir am „Zauberberg“ die Zähne ausgebissen habe. Und viel Camus! „Der Fremde“ und „Die Pest“ natürlich. Das ist ja eher ein morbides Buch, ein Stimmungsbuch.
WELT: Ihr Buch „Hotspot“ ist kein klassisches Sachbuch, eher eine Art Feldtagebuch. Es beginnt am 21. Januar 2020, als sie die erste Meldung über eine Corona-Infektion außerhalb Chinas erhielten. Wenn Sie den Hendrik Streeck von damals mit dem von heute vergleichen, was hat sich verändert?
Streeck: Ich war damals blauäugiger, was politische Entscheidungen und die Rolle der Wissenschaft in der Politik angeht. Ich dachte: Da wird konzertiert vorgegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Hinterzimmerabsprachen gibt, dass ein wissenschaftliches Interesse, etwas zu erforschen, so politisiert werden kann.
WELT: Hat sich Ihr Lebensgefühl in der Pandemie verändert?
Streeck: Ich bin ein optimistischer Mensch, immer schon. Das hat sich nicht geändert. Aber ich habe intensive Enttäuschungen erlebt. Etwa, wenn Aussagen aus dem Kontext gerissen werden. Dass ich im Juni gesagt habe, „Wir werden keine zweite Welle haben“, stand im Kontext, nämlich diesem: „Ich glaube, wir sind in einer kontinuierlichen Welle. Einer Dauerwelle, die immer wieder hoch- und runtergeht.“ Dennoch wird mir der erste Teil der Aussage heute noch in den sozialen Medien vorgehalten.
WELT: Als das Kanzleramt vor der letzten Lockdown-Verlängerung Wissenschaftler einlud, um die Ministerpräsidenten zu beraten, waren Sie nicht dabei.
Streeck: Ich hatte am Donnerstag vor diesem Termin ein Telefonat mit einem Ministerpräsidenten, der mich oder den Epidemiologen Klaus Stöhr in die Beratung holen wollte, und habe mir den entsprechenden Montag frei gehalten. Auch der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher wollte Stöhr offenbar in die Runde holen, ebenfalls ohne Erfolg. Zwei Wissenschaftler, die eine andere Sichtweise vertreten, wurden von Ministerpräsidenten vorgeschlagen – und dennoch ignoriert. Wäre ich Ministerpräsident, würde ich mir wünschen, ein möglichst breites wissenschaftliches Bild und auch Für- und Wider-Argumente zu hören.
WELT: Die Bundesregierung betont immer wieder, der Wissenschaft zu folgen.
Streeck: So einfach ist das nicht. Es gibt die Daten. Dann gibt es die wissenschaftliche Interpretation dieser Daten. Und am Ende muss, darauf basierend, eine politische Meinung gebildet werden. Ich sehe da auch die Politik in der Pflicht, nicht nur eine Position zu hören. Im niedersächsischen Sonderausschuss hatte ich etwa einen gemeinsamen Auftritt mit der Physikerin Viola Priesemann, die eher einen „No Covid“-Ansatz verfolgt. Erst hat sie gesprochen, dann ich, anschließend konnten sich die Abgeordneten ihre Meinung bilden. Das empfinde ich als vorbildlich.
WELT: Sie schreiben von einer „Infodemie“, die zeitgleich mit der Pandemie begann. Zuerst kamen die Horrorbilder aus Wuhan, unter denen viele Fake-Videos waren, etwa von Leuten, die auf der Straße tot umfielen. Dann die berüchtigten Bilder aus Bergamo, die Intensivstationen, Särge, Militärlastwagen. Die Panik, die damals weite Teile der Öffentlichkeit befiel, scheint Sie nicht erfasst zu haben.
Streeck: Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich eine Zeit im südlichen Afrika gearbeitet habe. Ich war in der chirurgischen Notaufnahme in Soweto, manchmal in 36-Stunden-Schichten. Dort habe ich dreimal erlebt, dass die Notaufnahme geschlossen werden musste, weil zu viele verblutende Menschen darin und auch davor standen. Es ist das größte Krankenhaus der südlichen Hemisphäre, und wir mussten die Notaufnahme schließen. Ob die Frau mit einer Schusswunde auch noch HIV hat, wird da nebensächlich, wenn 70 Prozent der Bevölkerung HIV haben.
WELT: Was haben Sie aus der Erfahrung gelernt?
Streeck: Ich finde es gerade als Virologe wichtig, dass man nicht nur den einseitigen Blick auf ein bestimmtes Virus hat, sondern dass man die ganze Situation in den Blick nimmt – in dieser Pandemie also auch die Nebenwirkungen und Kollateralschäden, die gerade wenig erfasst werden. Ich will als Virologe zum Beispiel gar nicht so viel zu der Frage nach den Kindern und den Schulen sagen. Viel wichtiger ist, was die Kinderärzte, Psychologen und Soziologen dazu sagen. Es geht ums große Ganze, um die Frage, wie wir gemeinsam am besten durch die Pandemie kommen.
WELT: Und, wie kommen wir da durch?
Streeck: Wir müssen anfangen, mit dem Virus zu leben. Das ist keine Floskel oder Platitüde. Wenn man sich eingesteht, dass wir dieses Virus nicht ausrotten können, kommt man schnell zu dem Punkt, dass die Infektionszahlen nicht unser alleiniges Instrument bleiben können. Denn es wird so sein, dass wir auch nach dem 14. Februar noch hohe Infektionszahlen haben, und dass auch im Herbst noch Infektionen geschehen – je nachdem, wie stark die Impfkampagne sein wird.
WELT: Sie sind nicht überzeugt davon, dass mit der Impfung alles vorbei ist?
Streeck: Die Daten deuten erfreulicherweise darauf hin, dass durch die Impfung alles reduziert wird: Weniger Leute infizieren sich, weniger kriegen schwere Verläufe, weniger geben das Virus weiter. Aber wenn in so kurzer Zeit so viele geimpft werden bei so viel Virus, dann kann es passieren, dass sich eine Mutation bildet, wo der Impfstoff nicht mehr ganz so gut wirkt.
WELT: Und was dann?
Streeck: Der Impfstoff wird weiter funktionieren, wir fangen nie bei Null an. Aber wir könnten eine Reduktion der Impfwirksamkeit haben. Daher werden wir auch nach dem Herbst mit diesem Virus umgehen müssen. Wir müssen uns jetzt schon die Frage stellen, wie – und Antworten darauf geben, die wir dann auch möglichst bald in die Tat umsetzen.
WELT: Das Ziel der Politik ist die Kontrolle des Virus, dafür soll eine Inzidenz von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner bürgen.
Streeck: Dass wir glauben, so ein Virus vollkommen kontrollieren zu können, ist problematisch. Was wir zurzeit erleben, könnte man die vierte Kränkung der Menschheit nennen. Freud hat ja drei Kränkungen aufgezählt: die durch Kopernikus, der feststellte, dass die Erde nicht den Mittelpunkt des Universums bildet. Dann die durch Darwin, der gezeigt hat, dass der Mensch und der Affe gemeinsame Vorfahren haben. Und die durch die Psychoanalyse, die herausfand, dass wir manchmal triebgesteuert handeln. Dass wir so etwas Kleines wie dieses Virus in absehbarer Zeit nicht ausrotten können, ist eine vergleichbare Kränkung.
WELT: Neue Strategien wie „Zero Covid“ oder „No Covid“ fordern die maximale Kontrolle, eine virenfreie Welt.
Streeck: Niedrige Fallzahlen oder keine Infektionen sind natürlich wünschenswert. Aber wie das vor allem langfristig gehalten werden soll, darauf gibt es bisher keine Antwort. Außer Deutschland riegelt sich dauerhaft ab.
WELT: Es heißt immer wieder, es sei unmöglich, die Risikogruppen gezielt zu schützen.
Streeck: Ich verstehe nicht, warum man nicht wenigstens probiert, diese Gruppen besser zu schützen – anstatt zu sagen, das geht nicht. Beispiele wie die Stadt Tübingen zeigen, dass es potentiell gehen kann.
WELT: Sie sind nach Gangelt gefahren, als alle vom deutschen „Wuhan“ sprachen, und haben in den Häusern der Infizierten Spuren gesichert, sogar Toilettenwasser entnommen, um alles über die Verbreitung des Virus zu erfahren. Sie beschreiben, dass sie dort eine humorvolle Atmosphäre erlebt haben, wenig Angst.
Streeck: Was ich in Gangelt beschreibe, ist die Wahrnehmung von Leuten, die infiziert waren, aber keine Symptome hatten. Da herrschte eher Gelassenheit. Dann gibt es die Perspektive derer, die jemanden verloren haben, das ist etwas ganz anderes. Und es gibt die Perspektive derer, die keinen Kontakt mit Corona haben, sich aber eine sehr starke Meinung gebildet haben.
WELT: Was meinen Sie?
Streeck: Ein gutes Beispiel ist „Long Covid“. Es wird ja suggeriert, dass fast jeder „Long Covid“ bekommt, also Langzeitfolgen. Dann heißt es, unter Verweis auf ein „Lancet“-Paper, rund siebzig Prozent der Kranken seien betroffen. Und es stimmt, das wird in diesem Aufsatz beschrieben. Aber wenn man sich das genau anguckt, sieht man: Das sind 76 Prozent, die – schweife ich gerade zu sehr ab?
WELT: Nein, bitte!
Streeck: Das betrifft 76 Prozent derer, die einen Krankenhausverlauf hatten und zum Teil intubiert werden mussten. Also gar nicht die unzähligen Infizierten, die nie im Krankenhaus waren. Als „Long Covid“ wird auch vermerkt, wenn man über längere Zeit müde ist und abgeschlagen. Jemand, der eine schwere Lungenentzündung hat – und das hatten diese Patienten alle – braucht aber im Schnitt sechs Monate, bis er wieder richtig auf die Beine kommt. Das gilt auch für andere Lungenentzündungen. Man wird nicht entlassen und läuft sofort wieder Marathon. Diese Beschreibung von Einzelfällen ist also verzerrend. Sie macht Angst vor dem Virus.
WELT: Wie sollte man dem Virus denn begegnen?
Streeck: Es ist ernst zu nehmen und darf nicht bagatellisiert werden. Aber es ist ein Virus, mit dem wir umgehen können.
WELT: Als Sie am 27. Februar vom ersten Corona-Fall in Bonn erfuhren, waren Sie gerade unterwegs zu einer Gala in Berlin. Sie kamen sofort zurück und besuchten den Indexpatienten, einen Studenten, in seiner Kellerwohnung, in Einmalkittel, Sichtschutz und FFP3-Maske. Waren Sie immer schon so abenteuerlustig?
Streeck: Das hat meine Zeit in Afrika charakterisiert. Ich habe auch in einem kleinen Buschkrankenhaus in Uganda hospitiert, da ging es immer um Infektionskrankheiten. Die sind für einen Arzt etwas Dankbares, weil man mit Antibiotika Schwerstkranke schnell wieder heilen kann. Der eine Virologe will verstehen, wie das Virus aufgebaut ist. Ich möchte wissen, wie reagiert der Mensch darauf. Das sind zwei Ausrichtungen innerhalb desselben Fachs.
WELT: In der Studie über Gangelt beschrieben Sie als weltweit erster Forscher das Symptom des Geruchs- und Geschmacksverlusts. Außerdem überraschten Sie mit einer Infektionssterblichkeit von 0,37 Prozent. Damals waren sehr viel höhere Zahlen im Umlauf. Hat sich der Befund bestätigt?
Streeck: Die Gangelt-Studie ist weltweit sehr gut aufgenommen worden, nur in Deutschland nicht – auch durch meine Fehler, aus Überforderung in der Kommunikation. Es gibt inzwischen sehr viele Studien zur Infection-Fatality-Rate, und auch diese kommen zu einem sehr ähnlichen Wert. Man beschreibt ja nicht eine Punktlandung, sondern eine Schwankungsbreite.
WELT: Nachdem Christian Drosten, ein Berater der Regierungspolitik, Ihre Studie öffentlich kritisiert hatte, gab es einen Shitstorm. Sie erklären sich das im Buch so, dass niemand die Botschaft hören wollte, dass das Virus nicht so tödlich ist wie befürchtet. Müsste eine Gesellschaft in der Krise nicht froh über gute Nachrichten sein?
Streeck: Ich glaube, dass da die Katastrophenbilder aus Bergamo nachgewirkt haben. Man hat dann falsch hochgerechnet: Wenn 0,37 Prozent der Bevölkerung versterben würden, dann hätten wir 250.000 Tote dieses Jahr. Und sobald mit Todesfällen argumentiert wird, herrscht Stille. Wenn Markus Söder dann noch sagt, jeder Tote sei ein kleiner Stich in seinem Herzen, hat er Recht – aber damit ist die Debatte auch beendet.
WELT: Aber wären denn 0,37 Prozent der Deutschen nicht rund 250.000 Tote?
Streeck: Das ist eine simplifizierte Rechnung und auch nicht lebensnah. Der Fehler in einigen ersten Modellen war zum Beispiel, dass der R-Wert als Konstante betrachtete. Ich müsste da jetzt eine ganze Kiste aufmachen…
WELT: Gerne!
Streeck: Es wird gerne gesagt, dass wir exponentielles Wachstum haben. Das ist auch richtig in einigen Phasen der Entwicklung, aber es ist auch richtig, dass es häufig eine heterogene Verteilung ist. Wir haben dann ein erratisches Wachstum, und das ist auf Dauer nicht exponentiell. Aber schon mit dieser Aussage hat man die meisten Leute verloren!
WELT: Versuchen Sie, es zu erklären.
Streeck: Wir sind als Gesellschaft keine Kiste voller Bälle, die alle ständig durcheinandergewirbelt werden, so dass sich alles gleichmäßig verteilt. Vereinfacht kann man sagen, dass sich die sozialsten Wesen am wahrscheinlichsten infizieren. Sobald die Verbreiter in der Pandemie einmal durch sind, verändert sich auch der R-Wert. Das hat auch einen Einfluss auf die Herdenimmunität. Zudem wird die Behandlung kontinuierlich besser, die Impfung kommt hinzu. Angela Merkel hat am Anfang der Pandemie einmal gesagt, dass die meisten von uns einmal Kontakt mit dem Virus oder Teilen des Virus haben werden. Und das ist immer noch so. Entweder durch die Impfung oder durch eine Infektion.
WELT: Der infizierte Student, den Sie besuchten, klagte darüber, er werde beschuldigt, das Virus nach Bonn eingeschleppt zu haben. „Die gesellschaftliche Ausgrenzung“, schreiben Sie, „ist generell ein Problem, das bei Infektionskrankheiten immer wieder auftritt und ganze Gruppen betrifft.“ Ob feiernde Jugendliche, Kinder oder Reisende. Sind Sie als Homosexueller besonders sensibel für solche Formen der Diskriminierung?
Streeck: Ich denke, das kommt eher aus meinem Forschungsgebiet HIV. Aids ist seit vielen Jahren eine stattfindende Pandemie, und auf den Konferenzen kommen Virologen, behandelnde Mediziner, Psychologen, Soziologen und Ethiker zusammen – übrigens auch mit Aktivisten. Denn ein zentrales Problem in der Aids-Bekämpfung sind Diskriminierung und Stigmatisierung: Leute wollen sich nicht testen lassen, weil sie Angst haben, als aussätzig zu gelten, nur weil sie HIV-positiv sind. Auch in der Corona-Pandemie sehen wir schon, dass Leute sich nicht testen lassen, weil sie sich nicht zwei Wochen in Isolation begeben wollen. Man muss daher weniger mit Härte, mehr mit Enabling arbeiten.
WELT: Wie soll das gehen?
Streeck: In der Aids-Pandemie arbeiten wir interdisziplinär, in dieser Pandemie nicht. Auch wird bei jeder Aids-Studie ein Community-Board eingerichtet: Die Betroffenen dürfen mitbestimmen. Auch wir brauchen mehr öffentliche Debatte, anstatt nur auf einige wenige Stimmen zu hören. Das bringt nur eine Spaltung, und am Ende wird darauf mit Trotz reagiert.
WELT: Auch Hedonismus und Ästhetik wurden in der Pandemie abgewertet.
Streeck: Wir fokussieren uns zu sehr auf die eine Infektion und schauen nicht, was unsere Reaktion mit dem Menschen macht. Mich bewegt die Verzweiflung der Künstler, wo die Krise an den Existenzen nagt. Da geht es nicht um die Wirtschaft, sondern um die Menschen. Man muss alle Schäden betrachten.
WELT: Sie schreiben, ein Lockdown sei ein künstlicher Staudamm: Öffnet man ihn wieder, fließt das Wasser ungehindert in alle Bereiche. Wie kommen wir nach dem 14. Februar da heraus?
Streeck: Ich denke, dass wir einen ähnlichen Verlauf haben werden wie im letzten Jahr, insgesamt vielleicht etwas früher aus dem Lockdown kommen. Außer wir verändern unsere Zielmarke der 50er-Inzidenz. Schleswig-Holstein hat gerade einen guten Aufschlag gemacht, in dem es einen Stufenplan entwickelt hat und Korridore definiert, in denen sich die Inzidenz bewegen kann. Das kann man natürlich noch verbessern, ist aber erstmal ein guter und pragmatischer Vorschlag.
WELT: Hat die Kontaktnachverfolgung denn schon einmal funktioniert?
Streeck: Wir hatten auch im letzten Sommer keine kontrollierte Pandemie, und da waren wir auf einer sehr niedrigen Inzidenz um die 10 auf 100.000.
WELT: Das klingt alles nicht so, als würden im Sommer 2021 endlich die goldenen Zwanzigerjahre beginnen.
Streeck: Ich habe letztes Jahr dafür geworben, dass man im Sommer mehr Mut wagen sollte. Das gab dann einen dieser Shitstorms. Dabei habe ich das nicht ohne Grund gesagt: Wir wissen, dass im Sommer kaum Übertragungen stattfinden – und vor allem, dass wir im Sommer fast nie schwere virale Pneumonien haben. Es wäre deshalb sinnvoll, diesen Sommer zu nutzen und Hygienekonzepte auf ihre Effektivität zu testen.
WELT: Wann beginnt denn die Zeit nach der Pandemie? Oder bleibt eine Gesellschaft zurück, die sich auf Dauer in eine Hochsicherheitszone verwandelt?
Streeck: Das hoffe ich nicht. Wir dürfen unser Leben nicht von Viren und Bakterien bestimmen lassen, dafür gibt es einfach zu viele davon. Ich sehe auch die Vorstöße, nur noch mit Corona-Impfpässen fliegen zu können, kritisch. Nicht alle Menschen – einschließlich der Kinder – dürfen oder können gerade geimpft werden. Ich hoffe, dass wir da ein gesundes Mittelmaß finden zwischen dem, was wirklich notwendig ist, und dem, was das Sicherheitsgefühl verlangt.
WELT: Sie sind also optimistisch, dass wir die Freiheit nicht dauerhaft aufgeben?
Streeck: Ja, ich bin für den Sommer definitiv optimistisch. Und für die Langzeitentwicklung auch.
WELT: Warum?
Streeck: Weil ich mir etwas anderes gar nicht vorstellen will.